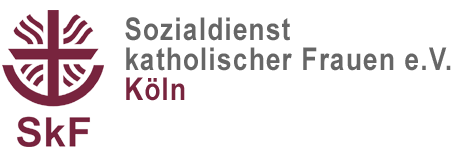Der 17.12. ist der internationale Tag zur Beendigung der Gewalt an Sexarbeiter*innen.
Eingeführt wurde dieser internationale Gedenktag anlässlich einer Reihe von Morden an Prostituierten in den 1980er Jahren in Seattle, USA.
„Dieser Tag mahnt uns, dass es viele Formen von Gewalt gegenüber Menschen gibt, die der Prostitution nachgehen“, so Monika Kleine, Vorstand des Sozialdienstes katholischer Frauen, der in Köln verschiedene Angebote für Prostituierte vorhält.
Sexarbeiter:innen werden öfter Opfer von Gewalt, Vergewaltigung und Mord als andere Menschen. Dies geschieht durch Kunden, Zuhälter oder andere Personen. Sie werden gesellschaftlich stigmatisiert, diskriminiert oder auch kriminalisiert.
„Selbst die Diskussion um ein Prostitutionsverbot ist oft gewaltvoll, weil Prostituierten meist generell die Fähigkeit und Freiheit abgesprochen wird, autonome Entscheidungen zu treffen. Stattdessen werden sie zum Opfer marginalisiert oder es werden ihnen psychische Erkrankungen oder Traumatisierungen unterstellt, sollten sie von sich behaupten, freiwillig in der Prostitution zu arbeiten“, so Kleine weiter.
Durch die Kriminalisierung und Nicht-Anerkennung ihrer Tätigkeit als legitime Erwerbstätigkeit werden Prostituierte an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Sie arbeiten trotz des Prostituiertenschutzgesetzes (ProstSchG) nicht nur unter wesentlich unsicheren, weil ungeregelten Bedingungen, sondern müssen auch höhere Hürden überwinden, wenn sie Straftaten anzeigen oder ihre Arbeitsbedingungen thematisieren und verbessern wollen.
„Am Beispiel der Geestemünder Straße, dem betreuten Straßenstrich, zeigt sich, dass unter klaren und transparenten Absprachen, in der Kooperation mit Polizei, Ordnungskräften und dem Gesundheitsamt gewaltsame Übergriffe auf Prostituierte nicht nur reduziert, sondern fast gänzlich verhindert werden können.
Nur mit solchen niedrigschwelligen Angeboten, bei denen aufsuchende Arbeit, Vertrauensaufbau und eine längerfristige Begleitung ineinandergreifen, ist es möglich, die Notlagen von Prostituierten zu erkennen, sie in Krisen zu entlasten und für Ausstiegshilfen zu erreichen“, zeigt sich Kleine überzeugt.
Kaum eine Berufsgruppe war durch die Pandemie so eingeschränkt wie Sexarbeiter:innen, die über Monate ein Arbeitsverbot hatten und nun trifft sie die aktuelle Wirtschaftskrise hart, weil auch ihre Kosten steigen und Kund:innen ausbleiben.
Schon während der Pandemie sind viele Prostituierte ins Dunkelfeld abgewandert und arbeiten jetzt wieder unter illegalen oder halblegalen und damit unter riskanten Arbeitsbedingungen. Sind sie nicht nach ProstSchG angemeldet, haben sie kaum eine Möglichkeit, einen Übergriff anzuzeigen ohne sich selbst zu belasten.
Der SkF e.V. Köln fordert daher einen Abbau der Diskriminierung, auch durch die, „die mit ihrer Forderung die Sexarbeit zu verbieten, eigentlich nur etwas Gutes bewirken“ wollen. Konkrete Forderungen des SkF sind: Nicht über, sondern mit den Sexarbeiter:innen reden, flexible Hilfen schaffen, die der hohen Mobilität der Menschen in der Sexarbeit Rechnung tragen und nicht an die Grenzen und Zuständigkeiten von Kommunen und Kreisen gebunden sind und vor allem, einen Verzicht auf gesetzliche Neuregelungen wie die Freierbestrafung.