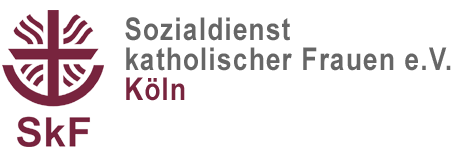Am 25. November ist der Tag gegen Gewalt gegen Frauen und Kinder. Vor einigen Tagen wurde erstmals ein Lagebild „Geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten 2023 durch das Bundeskriminalamt“ erstellt und veröffentlicht.
In das Lagebild eingeflossen sind politisch motivierte Straftaten, die sich gegen Frauen oder das weibliche Geschlecht richten sowie Sexualstraftaten, Häusliche Gewalt, Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, Digitale Gewalt und Femizide, von denen Frauen überwiegend betroffen sind.
In allen Bereichen zeigt das Lagebild eine Zunahme von Gewalttaten gegen Frauen.
2023 wurden 180.715 weibliche Betroffene von Häuslicher Gewalt erfasst, eine Steigerung um 5,6%. 52.330 weibliche Personen wurden Opfer sexueller Gewalt, 6,2 % mehr als im Vorjahr.
Es wurden 938 Tötungsdelikte an Frauen von der Polizei registriert, bei 360 Frauen und Mädchen waren die Tötungsdelikte vollendet. Damit starb in Deutschland im Jahr 2023 fast jeden Tag eine Frau oder ein Mädchen durch Gewalt, 247 von ihnen wurden von Menschen in ihrem häuslichen und familiären Umfeld getötet.
Digitale Gewalt erfuhren 17.193 Frauen, 25% mehr als 2022. 591 weibliche Personen und damit 6,1% mehr als im Vorjahr waren von Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung betroffen.
Bei den vorurteilsgeleiteten Straftaten im Bereich der politisch motivierten Kriminalität wurden 322 Taten registriert, „ein Anstieg um 56,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl der frauenfeindlichen Gewaltdelikte hat sich mit 29 innerhalb eines Jahres verdoppelt.
„Diese Zahlen, das wissen wir aus unserer täglichen Arbeit im Gewaltschutz, sind nur die Spitze des Eisbergs, weil die Betroffenen die Gewalt weiterhin ertragen oder versuchen sich aus der Beziehung zu lösen ohne das Gewaltgeschehen öffentlich werden zu lassen“, so Andrea Albert, Leiterin des Gewaltschutzzentrums beim Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Köln (SkF).
Studien zeigen, dass die gesellschaftlichen Kosten alleine von häuslicher Gewalt - Polizeieinsätze, gerichtliche Verfahren, medizinische Behandlung und psychosoziale, Arbeitsausfälle, Produktivitätsverluste und zusätzliche Sozialleistungen – sich im Milliardenbereich bewegen.
Ute Theisen, Vorstandsvorsitzende des SkF Köln macht das Dilemma deutlich: „Alle Studien und Erhebungen zeigen, dass Gewalt gegen Frauen kein individuelles Problem ist, das die Betroffene selbst lösen muss, sondern ein gesamtgesellschaftliches Thema. Deutschland hat schon vor Jahren die Instanbul-Konvention unterzeichnet, der notwendige Ausbau des Hilfesystems ist jedoch ausgeblieben. Ob das Gewalthilfegesetz der Ampel oder das der CDU/CSU im Bundestag zeitnah verabschiedet wird, bleibt offen. Offen bleibt auch, wie die Umsetzung der Instanbul-Konvention finanziert werden soll, wenn Bund, Länder und Kommunen Sparhaushalte vorlegen, die in Köln auch die Gewaltschutzarbeit der beiden Interventionsstellen betreffen, die ohnehin schon seit Jahren nur durch zusätzliche Spendengelder und Eigenmittel aufrecht erhalten werden können.“
Das BKA vermutet hinter den steigenden Zahlen einen gesellschaftlichen Wandel, indem vor allem Männer auf die zunehmende Emanzipation von Frauen mit verbaler und/oder körperlicher Gewalt reagieren würden, um ihren Machtanspruch zu sichern. Gleichzeitig könne aber auch die Emanzipation dazu führen, dass Frauen eher bereit sind, geschlechtsspezifische Straftaten anzuzeigen.
Andrea Albert und Ute Theisen neigen erster Erklärung zu: „Die Erfolge einer antiemanzipatorischen Partei wie der AfD lassen einen gesellschaftlichen Rückschritt befürchten, der vor allem Frauen und Mädchen betrifft. Umso wichtiger ist es, jetzt die Hilfen für gewaltbetroffene Menschen zu stärken und die Prävention auszubauen.“
Für den SkF ist klar, Gewalt gegen Frauen ist kein individuelles Problem oder ein Minderheitenthema, sondern ein gesamtgesellschaftliches. Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist eine Menschenrechtsverletzung und damit ein Zeichen der Ungleichstellung von Frauen und Männern. 50% der Bevölkerung können von körperlicher und psychischer Gewalt, Abwertung oder Hass im Netz betroffen sein und das oft nur, weil sie entweder ihre Rechte und ihre Freiheit in Anspruch nehmen und sich entsprechend positionieren oder aber noch schlimmer, weil sie einfach da sind und leben.
Die Istanbul-Konvention als internationales Abkommen zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt gibt starke Impulse für die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen auf allen staatlichen Ebenen. Sie müssen endlich umgesetzt werden.